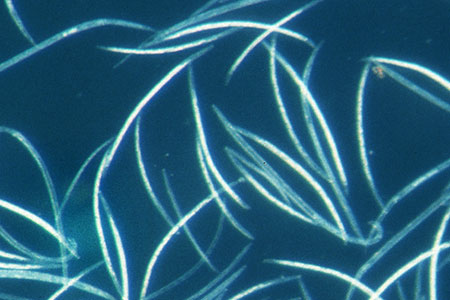Zwar ziehen sich epidemisch auftretende Absterbeprozesse („Kiefernsterben“) bereits seit langem wie ein roter Faden durch die Geschichte der europäischen Waldkiefernwälder. In jüngster Vergangenheit hat jedoch die Schadentwicklung wohl im Zusammenhang mit der Häufung von Hitzeperioden so an Dynamik gewonnen, dass die Waldkiefer an besonders warmen Standorten zukünftig nicht mehr als Hauptbaumart tauglich erscheint.
Schwarzkiefer bietet auf schwierigen Standorten eine Alternativen zur Waldkiefer
Bei der Suche nach Alternativen zur Waldkiefer kommen in solchen Warmgebieten bei den Nadelbäumen nur wenige Baumarten in Betracht. Einbezogen werden sollte dabei auf jeden Fall die Schwarzkiefer, die hier aufgrund ihrer günstigen Eigenschaften häufig als aussichtsreichere Nadelbaum-Kandidatin für trockene, steinige und flachgründige Standorte aber auch mäßig nährstoffreiche Lehm- und Sandböden ins Spiel gebracht wird: Sie wächst in der kollinen und montanen Vegetationsstufe, gilt als genügsam in ihren Nährstoff- und Wasseransprüchen, ist hitzebeständig und je nach Herkunft mäßig frostsicher – für eine Baumart mit auch mediterranem Verbreitungsgebiet keine selbstverständliche Eigenschaft.
Erfreulicherweise reicht das – allerdings zersplitterte – natürlichen Verbreitungsgebiet bis nach Österreich. Die Taxonomie der Spezies Pinus nigra ist dabei nicht ganz einfach: Bereits Mirov listet 1967 verschiedene Schwarzkiefer-Varietäten auf. Heute wird die Baumart auf Basis räumlich-genetischer Strukturen in fünf Unterarten eingeteilt: P.n. salzmanii, P.n. laricio, P.n. nigra, P n. pallasiana und P.n. dalmatica.
In der vorliegenden Untersuchung wurden die Unterarten P.n. nigra var. austriaca sowie P.n. laricio var. calabricaund P.n.var.corsicana verglichen.
Die in Europa heimische Baumart befindet sich damit wanderungstechnisch quasi bereits in Schlagdistanz zu Deutschland. Und auch waldbaulich ist die Schwarzkiefer hier keine Unbekannte. Sie ist in der Lage, auf waldbaulich schwierigsten Standorten stabile Bestände zu bilden. In Südwestdeutschland kommt sie seit langem erfolgreich zum Einsatz: auf ausgesprochen wuchsschwachen, flachgründigen Karbonatböden in Warmgebieten wie dem Taubergrund, oder als Erstaufforstungs-Baumart beispielsweise auf der Schwäbischen Alb. Also unter Standortsverhältnissen, unter denen die Waldkiefer in der jüngsten Vergangenheit unter massiven Vitalitätseinbußen leidet.
Schwarzkiefer vs. Waldkiefer
Auch das Versuchsflächennetz Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) umfasst einige Versuche mit Schwarzkiefern, die vor allem auf wuchsschwachen Standorten mit ungünstiger Wasserversorgung wachsen. Aus Versuchen mit Schwarzkiefern sind Daten aus mehr als 300 Aufnahmen von Versuchsfeldern mit Schwarzkiefer als Hauptbaumart verfügbar. Das ist zwar deutlich weniger als bei Waldkiefer (gut 1.800 Feldaufnahmen) – aber immerhin!
Und das Versuchswesen befasst sich nicht erst seit gestern mit Schwarzkiefer: Bereits für den Anfang des 20. Jahrhunderts liegen Daten einzelner Versuchsflächen vor. Das Gros der verfügbaren Aufnahmedaten stammt allerdings aus Messungen ab der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts (>90%).
Vor dem Hintergrund dieser doch recht substantiellen Datenbasis lag es nahe, das Versuchsflächennetz daraufhin abzuklopfen, ob sich die Erwartungen an die Schwarzkiefer empirisch bestätigen lassen und wie der Vergleich zur Waldkiefer ausfällt.
Hier können Sie den Originaltext mit Daten-/Grafikteil und Literatur herunterladen.
Schwarzkiefer besser als Waldkiefer – aber nur mit geeignetem Vermehrungsgut!
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass auch die Schwarzkiefer kein Wunderbaum ist. Selbstverständlich kommt auch sie unter ganz extremen Verhältnissen an ihre Grenzen. Unter schwierigen Standortverhältnissen ist sie aber offenkundig deutlich härter im Nehmen als Waldkiefer. Und sie wächst dort noch – nun ja nicht umwerfend – aber immerhin deutlich besser als Waldkiefer. Damit darf sie bei weiter fortschreitendem Klimawandel durchaus zum Kreis interessanter „alternativer“ Baumarten gezählt werden.
Da Vergleichsanbauten auf herkunftsbedingte Unterschiede beispielsweise bei Wachstum, Qualität und Mortalität hinweisen, wird deutlich, dass auch bei Schwarzkiefer die Herkunftswahl eine wichtige Rolle spielt. So zeichnen sich sowohl in den baden-württembergischen Versuchen als auch in jüngeren bayrischen Versuchen vor allem Herkünfte aus dem südlichen Bereich der Unterart P.n. laricio durch überdurchschnittliches Höhenwachstum aus. Außerdem liegen auch von weiter nördlich gelegenen Praxisanbauten mit korsischen Schwarzkiefer-Herkünften guten Erfahrungen vor.
Natürlich ist es am sinnvollsten, grundsätzlich die bestgeeignete Herkunft zu verwenden. Wenn diese jedoch nicht bekannt – weil beispielsweise regional aussagefähige Vergleichsanbauten fehlen – beziehungsweise wenn sie nicht verfügbar ist, kann auch eine andere Herkunft verwendet werden. Tatsächlich schneidet in den bis dato bekannten Vergleichsanbauten keine Herkunft durchgängig so schlecht ab, dass von einem Anbau unbedingt abgeraten werden müsste.
Keine Kompromisse verträgt dagegen die Verwendung hochwertigen und herkunftssicheren Vermehrungsguts. Diesbezüglich sollte vor allem marktverfügbares, aus Samenplantagen stammendes Vermehrungsgut der Kategorie „Qualifiziert“ stärker als bisher genutzt werden. Für die Unterarten P.n. nigra und P.n. laricio sind dazu jedenfalls entsprechende Saatgutquellen in Deutschland und Frankreich vorhanden. Die Verwendung von Schwarzkiefern ohne forstlichen Herkunftsnachweis ist inakzeptabel; der Einsatz von GaLa-Vermehrungsgut (Garten- & Landschaftsbau) für Zwecke der forstlichen Praxis ist schlicht ein Kunstfehler!
Und die zusammenfassende Moral von der Geschicht‘: im Klimawandel vergiss‘ die schwarze Kiefer nicht!