
Abb. 1 - Der Rothirsch breitet sich langsam ins Mittelland aus. Foto: Thomas Schubert/pixelio.de
Um 1850 war der Rothirsch in der Schweiz aufgrund starker Bejagung beinahe verschwunden. Seither wachsen die Bestände und das Verbreitungsgebiet des Hirschs ununterbrochen und stetig wieder an. Ein Beispiel: Im Schweizer Nationalpark hatte ein Parkwächter 1915 die ersten Hirsche beobachtet. Das war ein Jahr nach der Gründung des Schutzgebiets. 70 Jahre später schätzte man dort den Bestand bereits auf 5000 Tiere. Gemäss der Eidgenössischen Jagdstatistik wurden 1933 im Kanton Graubünden 264 Hirsche erlegt. In den folgenden Jahrzehnten eröffneten immer mehr Kantone die Jagd auf das Rotwild (Abb. 2).
Lange hielt man es nicht für möglich, dass der Hirsch das Mittelland besiedeln könnte. Doch der Rothirsch zeigt immer wieder und aktuell von neuem, dass er sich schon längst an die heutige Kulturlandschaft angepasst hat. Er ist auch fähig, in Räumen zu leben, welche Wildspezialisten als suboptimal einstufen. Und er lebt dort offenbar sehr gut.
Da der Hirsch bei der Besiedlung von neuen Gebieten oft zurückhaltend bejagd wird, nehmen an vielen Orten auch die Schäden zu. Diese unterschätzt man am Anfang häufig, und nachher sind sie so gross, dass sie kaum mehr mit einfachen Mitteln in den Griff zu kriegen sind. Die entstandenen Schäden müssen Waldbesitzer und Landwirte oft einseitig tragen, weil eine einfache und zweckdienliche Abgeltungspraxis an vielen Orten fehlt. Dadurch entstehen Konflikte, welche die Freude über die Rückkehr des Rothirsches unnötig trüben.
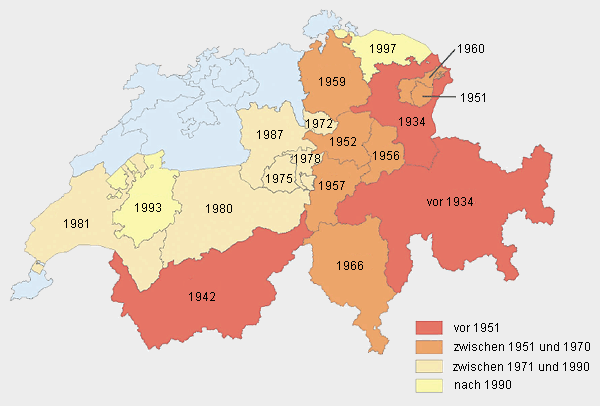
Abb.2 - Beginn einer regelmässigen Jagd auf Hirsche in den Schweizer Kantonen.
Schälwunden mindern den Ertrag
Schälschäden sind ein lokales Problem und kommen vor allem in den Wintereinständen des Rotwilds vor. Für die betroffenen Waldeigentümer können sie folgenschwer sein (Abb. 3 und 4). Die jahrelange Aufbauarbeit am Wald wird innert kurzer Zeit vernichtet. Das Schälen vermindert die Holzqualität stark und schafft Eintrittspforten für Fäulepilze. Das führt bei der Fichte zu Rotfäule und bei der Buche zu Weissfäule. Der wertvollste Stammteil wird erheblich entwertet, die Holzerträge sinken. Derart geschädigte Stämme erfordern bei der Ernte zusätzliche Arbeitsgänge und entsprechenden Mehraufwand. Die Tanne ist ähnlich zu beurteilen wie die Fichte, die Esche wie die Buche. Die Wundheilung anderer Baumarten wie Föhre, Lärche, Douglasie oder Eiche ist besser, weshalb hier weniger gravierende Qualitätseinbussen entstehen.
In der Schweiz haben Waldeigentümer theoretisch Anspruch auf eine Vergütung der Schäden. Im Grundsatz ist dieser Anspruch im Eidgenössischen Jagdgesetz festgehalten (Art. 13.1): "Der Schaden, den jagdbare Tiere an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen und Nutztieren anrichten, wird angemessen entschädigt." Das Ausmass des Schadens hängt von vielen Faktoren ab: Alter der Bäume, Umtriebszeit, Baumart, Bestockungsgrad, Wüchsigkeit des Standorts, Anteil geschädigter Stämme, Schadengrad am Einzelbaum, Holzerntekosten, Holzerlös zum Zeitpunkt der Ernte, aktuell gültiger Zinsfuss, usw. Diese Komplexität führt allzu oft dazu, dass gar nicht entschädigt wird und dass Waldeigentümer die Schäden selbst tragen müssen. Eine praxisgerechtere Regelung der Wildschadenvergütung ist deshalb wünschenswert (siehe hier).
Die Wertverluste, die durch das Schälen entstehen, fallen erst viele Jahre später bei der Holzernte an. Es stellt sich deshalb die Frage, ob ein geschädigter Bestand nicht besser vorzeitig verjüngt wird, um einem Jungwald Platz zu machen. Viele Beispiele aus Wissenschaft und Praxis zeigen, dass die Unkosten bei einem vorzeitigen Abtrieb in aller Regel höher sind als die Verluste, wenn man den Bestand bis zur Hiebsreife weiterwachsen lässt.
In der Fachliteratur findet man für geschälte Fichtenbestände Schadensbeiträge von Fr. 3000.– bis Fr. 15'000.–/ha. Die Werte variieren aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Verhältnisse. Bei Teilschäden reduziert sich der Verlust entsprechend dem Schadensprozent. Bedeutend höhere Beträge ergeben sich in der Regel, wenn ein geschädigter Bestand vorzeitig verjüngt wird und man die Kosten aufgerechnet, die in Form von Jungwaldpflegearbeiten in diesen Bestand investiert worden waren.
Schälschäden im Schweizer Wald

Abb. 3 - Geschälte Tanne im Toggenburg. Foto: Oswald Odermatt (WSL)

Abb. 4 - Geschälter Eschenbestand. Foto: Oswald Odermatt (WSL)
Gemäss dem dritten Schweizerischen Landesforstinventar LFI3 weisen schweizweit 4,4% der Bäume zwischen 130 cm Höhe und 11 cm Brusthöhendurchmesser Verletzungen durch Schlagen/Fegen und Schälen auf. Die Anteile der beiden Schadenarten werden dabei nicht gesondert ausgewiesen, Schälschäden dürften aber den kleineren Teil ausmachen.
Die Fachgruppe Waldschutz Schweiz der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL erfasst ausserordentliche Wildschadenereignisse im Schweizer Wald laufend. 1997 meldeten 74 Forstämter jährlich wiederkehrende Schälschäden. In 13 Forstkreisen traten dabei massierte Schälschäden mit mehr als einem Drittel betroffener Stämme auf.
Im Werdenberg (Kanton St. Gallen) sind Schälschäden seit 1965 ein Dauerproblem und haben in den letzten Jahren sehr grosse Ausmasse erreicht. Die über Jahrzehnte immer wieder aufgetretenen Schälschäden haben zuletzt zu einer gerichtlichen Einklage von Schadenvergütungen durch die Waldeigentümer geführt. Nach der ersten gerichtlichen Beurteilung dürften bei den Vergütungsansprüchen Abzüge für nicht standortgemässe Bestockungen erfolgen, entsprechend dem kantonal geltenden Wildschadenreglement. Das bedeutet, dass waldbauliche Handlungen von früher als Begründung herangezogen werden, um den heutigen Waldeigentümern die Vergütung der Schäden vorzuenthalten. Dabei wurden die bestehenden Waldstrukturen zu einer Zeit geschaffen als noch niemand die Entwicklung der Rotwildbestände voraussehen konnte. Auch in anderen Teilen des Kantons St. Gallen nehmen Rotwildbestände und ihre Einwirkungen auf den Wald zu. So sind im Toggenburg im vergangenen Jahr lokal massive Schälschäden aufgetreten (Abb. 3).
Im Kanton Graubünden wurde in den 1980er-Jahren die systematische Fütterung aufgegeben und durch Biotop-Hegemassnahmen abgelöst. Schälschäden traten danach nur noch ausnahmsweise auf. Im Prättigau kam es jedoch in den vergangenen Wintern in talnahen Lagen wieder verbreitet zu Schälschäden. Schnee und Kälte verknappten die verfügbare Nahrung, so dass die Hirsche auf die Grassilage in den Siloballen der Landwirtschaft auswichen. Im Umkreis solcher künstlicher Nahrungsquellen wurden vor allem Eschenstangenhölzer, aber auch Fichten und andere Baumarten geschält (Abb. 4).
Stark betroffen ist seit längerer Zeit auch das Weissbachtal im Kanton Appenzell Innerrhoden. Ein grosser Anteil reiner Fichtenbestände in Verbindung mit einer starken touristischen Nutzung prädestiniert das Alpsteingebiet für Schälschäden. Die Fichtenbestände wurden zu einer Zeit begründet, als es noch keine Hirsche im Gebiet gab und demzufolge Schälschäden kein Thema waren. Bis der Wald eine naturnahe und weniger schäl-anfällige Baumartenzusammensetzung aufweist, versuchen die Forstleute, den Schaden mit technischen Massnahmen in Grenzen zu halten.
Im Kanton Schwyz wurden im Frühjahr 2009 zwei talnahe Waldungen in der Umgebung von Unteriberg praktisch vollständig geschält. Im Kanton Glarus sind die am tiefsten gelegenen Bereiche der Jagdbanngebiete stark von Schälschäden betroffen.
Starke Bejagung ist Pflicht
Der Nahrungsbedarf von Rotwild ist enorm. Er beläuft sich auf 15 bis 20 kg Grünmasse pro Tag. Forschungen zeigen, dass ein Stück Rotwild im Verlaufe von drei Wintermonaten im Durchschnitt 23‘500 Nadelholztriebe abbeisst.
Schälschadenfälle eignen sich schlecht als Eingangsgrösse für die Jagd, denn sie treten zu unregelmässig auf. Ob ein Rotwildbestand an den Lebensraum angepasst ist, zeigt sich vielmehr am Verbiss. Wenn Rotwild die Wahl hat, zieht es Triebe und Knospen der Holzrinde vor. Wird der Verbiss als Eingangsgrösse für die Jagd berücksichtigt und diese mit einer von Anfang an starken Bejagung des Rotwildes umgesetzt, so bleiben die Schälschäden klein. Als Grundregel kann gelten: Solange die Waldverjüngung nicht gefährdet ist, ist auch das Schälrisiko gering.
Teure Krücken: technische Schutzmassnahmen

Abb. 5 - Schälschutzmatte an Bergahorn. Foto: Oswald Odermatt (WSL)

Abb. 6 - Die Schälschutzmatte wird mit Metallklammern verschlossen. Foto: Oswald Odermatt (WSL)
Schälschäden lassen sich am Einzelbaum durch verschiedene technische Methoden verhindern. Diese sollen aber eine Notlösung bleiben.Im Folgenden die gängigsten Methoden:
- Polynet: Der Stamm wird von oben nach unten mit einem 15 cm breiten Netz umwickelt. Gewisse Produkte werden infolge der UV-Strahlung der Sonne schnell spröde und zerfallen.
- Matte: Ein Kunststoffnetz wird in einer Länge von 1,8 m um den Stamm gelegt und mit Metallklammern verschlossen. Die Matte steht dank der Stabilität des Materials selbstständig (Abb. 5 und 6).
- Chemie: Der Stamm wird mit einem quarzsandhaltigen Mittel bestrichen. Streichmittel ohne Quarzsand haben sich nicht bewährt. Vor der Anwendung ist das Mittel gut umzurühren, damit die Quarzkörner nicht im Kübel absinken.
- Grüneinband: Bei 3 bis 4 m hohen Fichten mit grünen Ästen im unteren Bereich werden die Äste parallel zum Stamm nach unten gebogen und mit einem Bindedraht zusammengebunden. Diese Methode ist arbeitsaufwändig und nur in Ausnahmefällen angebracht.
Wer einzelne Bäume vor Schälschäden bewahren möchte, sollte alle gefährdeten Auslesebäume im Wildeinstandsgebiet schützen. Sonst verursacht man lediglich eine Verlagerung der Schäden. Wenn nämlich das Rotwild auf andere Bäume ausweichen kann, entstehen Kosten für Verhütung und die Schäden sind trotzdem da!
Fütterung fördert Schäden
Gelegentlich wird empfohlen, Rotwild in Notzeiten zu füttern, damit es nicht Bäume schälen muss. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Fütterung kein geeignetes Mittel ist, um Verbiss- und Schälschäden zu verhindern. Verschiedene Fütterungsversuche schienen zwar zunächst Erfolg zu haben, dieser blieb aber örtlich begrenzt und hielt nur kurze Zeit an. Heute setzt sich die Erkenntnis durch, dass Rotwildschäden am Wald durch Futtergaben nicht verhindert werden können und sich durch nicht artangepasste, nicht wildtiergerechte Nahrungsvorlagen sogar verstärken. In der Frage, ob die Fütterung des Rotwildes sinnvoll ist, stellt man in der Schweiz einen breiten Konsens fest: Es gibt keine Fachorganisation, die sich für die Fütterung von Rotwild einsetzt.
Enge Zusammenarbeit nötig
Waldeigentümer, Förster und Jäger sollten in einvernehmlicher Zusammenarbeit eine optimale Ausgestaltung des Beziehungsgefüges Wald/Wild anstreben, die möglichst ohne technische Wildschadenverhütungsmassnahmen und Abgeltung der Wildschäden auskommt. Die Ausbreitung des Rothirsches ins Mittelland erfordert genau eine solche Zusammenarbeit, da technische Verhütung und Abgeltungspraxis nicht befriedigen können.
Waldeigentümer und Förster sollten sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, nämlich auf das Holzen. Damit gelangt genügend Licht auf den Waldboden, was das Äsungsangebot erhöht. Die Jäger wiederum sollten das Rotwild von Anfang an stark bejagen, damit die Schäden überschaubar und lokal lösbar bleiben. Lebensraumverbesserungen für das Wild sind nur dann sinnvoll, wenn die Bestände jagdlich ausreichend reguliert sind, denn bei zu tiefen Jagddruck führen verbesserte Lebensbedingungen zwangsläufig zu höheren Wildbeständen und auch zu stärkeren Schäden. Nur durch enge Zusammenarbeit können Waldeigentümer, Förster und Jäger ihre Freude am Rothirsch langfristig behalten.











