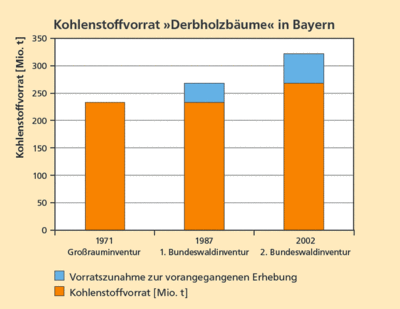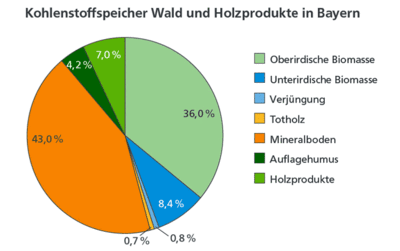Die Wälder unserer Erde speichern aktuell etwa 653 Milliarden Tonnen Kohlenstoff (in allen Kompartimenten inkl. des Mineralbodens). Da bei der Bindung einer Tonne Kohlenstoff (C) der Atmosphäre 3,67 Tonnen Kohlendioxid (CO2) entzogen werden, entspricht das in etwa einer Menge von 2.400 Milliarden Tonnen CO2. Die enorme Bedeutung der Wälder zeigt sich, wenn man dem Gesamtspeicher Wald die jährlichen weltweiten energiebedingten Emissionen gegenüberstellt (ca. 32 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr 2005): Die Wälder speichern in etwa die energiebedingten Emissionsmengen von 75 Jahren!
Die Kohlenstoff-Hot-Spots der Erde liegen dabei in Südamerika (188 Mrd. Tonnen C), insbesondere in den tropischen Zonen, sowie in Russland (128 Mrd. Tonnen C), wobei hier der Speicher Boden eine sehr wichtige Rolle spielt (besonders die Permafrostböden Sibiriens).
Diese besondere Bedeutung der Wälder zum Klimaschutz wird der breiten Öffentlichkeit zunehmend bewusst. Wenig bekannt sind allerdings noch Größe und Umfang der Leistung der Wälder zum Klimaschutz.
Ermittlung des bayerischen Speichers: alle Kompartimente beachten
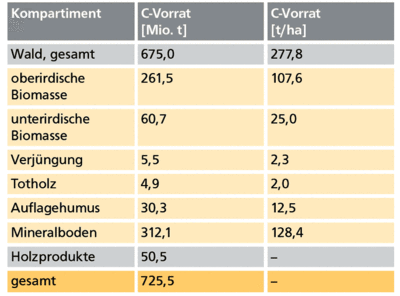
Tab. 1: Der Kohlenstoffvorrat in den Wäldern Bayerns (Gesamtfläche und pro Hektar) aufgeteilt in Kompartimente
Auch die Wälder Bayerns binden signifikante Mengen an Kohlenstoff. Entscheidend für die Ermittlung des genauen Speichers ist, alle Kompartimente des Waldökosystems zu betrachten. Das sind vor allem die Derbholzbäume, die Verjüngung, das Totholz sowie der Boden.
Als Datenbasis dienen nationale Inventuren. Die Bundeswaldinventur (BWI) dient als Grundlage zur Bestimmung der Kompartimente Derbholzbiomasse, Verjüngung und Totholz. Anhand der Informationen aus der Bodenzustandserhebung wird der Kohlenstoffspeicher Boden abgeleitet. Die Summe aller Pools ermöglicht schließlich eine vollständige Betrachtung des Kohlenstoffspeichers im Ökosystem Wald für Bayern. Anhand von Arbeiten aus der Vergangenheit kann die Entwicklung des Kohlenstoffspeichers in den letzten Jahrzehnten abgeleitet werden.
Kohlenstoffspeicher Wald in Bayern: aktuell rund 675 Mio. Tonnen
Derbholz
Der gesamte Kohlenstoffspeicher der lebenden Dendromasse (alle Bäume ab einem Brusthöhendurchmesser = BHD von 7 cm) inklusive der Wurzelbiomasse betrug 2002 (letzte BWI) rund 322 Millionen Tonnen. Das entspricht einem Vorrat von 133 Tonnen pro Hektar. Davon sind etwa 81 Prozent in der oberirdischen und 19 Prozent in der unterirdischen Biomasse gebunden.
Verjüngung
In der Verjüngung wird der Kohlenstoffspeicher auf rund 5,5 Millionen Tonnen bzw. 2,3 Tonnen pro Hektar geschätzt. Leider ist die Datenbasis für die Verjüngung relativ ungenau, am geringen Anteil der Verjüngung an der Gesamt-Kohlenstoffspeicherung ändert das jedoch nichts.
Totholz
Im Totholz wurde eine Gesamtkohlenstoffspeicherung von rund 4,9 Millionen Tonnen ermittelt, was einer Menge von knapp zwei Tonnen pro Hektar entspricht. Fast die Hälfte des Totholzes ist im Stadium mit beginnender Zersetzung gebunden (44 %).
Boden
Bayerns Böden binden bis zu einer Bodentiefe von maximal 150 Zentimetern inklusive des Auflagehumus rund 141 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar. Umgerechnet auf die Waldfläche Bayerns entspricht das einem Vorrat von rund 342 Millionen Tonnen. Damit liegt der Bodenkohlenstoffvorrat sogar etwas über dem Vorrat der Baumbiomasse.
Gesamtspeicher Wald
Der Gesamtspeicher Wald in Bayern beträgt rund 675 Millionen Tonnen bzw. durchschnittlich 277,8 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar. Ausgedrückt in CO2-Einheiten entspricht das einem Vorrat von etwa 2.480 Millionen Tonnen. Damit hat unser Wald in Laufe der Zeit etwa die 28-fache Menge der CO2-Jahresemission gespeichert.
Entwicklung des Kohlenstoffspeichers Wald in Bayern
Der Kohlenstoffspeicher in Wirtschaftswäldern ist nicht statisch, sondern befindet sich in einem steten dynamischen Prozess. Bei einer Nutzung, die den Zuwachs überschreitet fungiert er als Kohlenstoffquelle, wird weniger genutzt als nachwächst, wirkt er als Kohlenstoffsenke.
Ob ein Wald eine Kohlenstoffquelle oder -senke darstellt, hängt letztlich vom Betrachtungszeitraum bzw. vom Zeitpunkt ab. Bewirtschaftete wie unbewirtschaftete Wälder werden zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Vorratsmaximum erreichen. Ab dann wird der durchschnittliche Vorrat je nach Zielausrichtung gehalten oder wieder auf ein bestimmtes Maß reduziert. Bayerns Wälder haben in den letzten Jahrzehnten als Kohlenstoffsenke fungiert, da mehr Kohlenstoff durch Zuwachs aufgenommen als durch Nutzung dem Wald entzogen wurde (Abb. 1).
Die Auswertungen zur Bodenzustandserhebung lassen sich aufgrund methodischer Unterschiede zwischen den Inventuren nur eingeschränkt vergleichen. Es lässt sich aber feststellen, dass sich die Speicher Boden und Auflage zumindest nicht verringert haben. Für das Totholz gibt es noch keine Vergleichswerte, da dieses erstmals in der BWI2 umfassend erhoben wurde.
Kohlenstoffspeicher Holzprodukte
Holzprodukte wirken sich positiv auf das Klima aus, indem sie die Speicherung des Kohlenstoffs, der im Wald gebunden war, um die spezifische Nutzungsdauer des Produktes verlängern. Allerdings spielen die Substitutionseffekte des Holzes (Material- und Energiesubstitution) langfristig eine weitaus bedeutendere Rolle (vgl. Kasten). Alle Produktsegmente zusammengefasst speichern die in Bayern im Gebrauch befindlichen Holzprodukte etwa 50,5 Millionen Kohlenstoff.
Nimmt man die Holzprodukte zum Speicher Wald hinzu, erweitert sich der Gesamtspeicher auf 725,5 Millionen Tonnen (Tabelle 1). Die Holzprodukte spielen als Speicher mit sieben Prozent zwar eine Rolle, die direkte Speicherung im Wald ist aber weitaus bedeutender (Abb. 2). Jedoch ist der Holzproduktespeicher wohl der Speicher, der in naher Zukunft am schnellsten zu beeinflussen ist.
Kaskadennutzung als Zukunftsmodell
Aufgrund der hohen Vorräte und nicht zuletzt auch aufgrund der hohen Nachfrage nach Holz aus unseren heimischen Wäldern ist absehbar, dass die Senkenfunktion der Wälder in Bayern in Zukunft an ihre Grenzen stoßen wird. Umso wichtiger ist es, auch die Holzprodukte in die Gesamtbewertung mit einzubeziehen und auch in Zukunft effizient mit der Ressource Holz umzugehen. Insbesondere die heute bereits vielfach geforderte Kaskadennutzung sollte dafür als Instrument dienen.