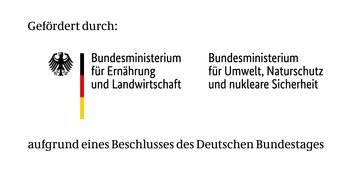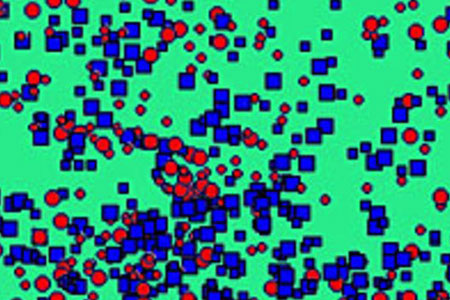Der bereits jetzt hohe Kenntnisstand zum Klimawandel sollte genügen, um durchdachte Entscheidungen im Bereich Anpassung und Vermeidung zu treffen und so sicherer und gestärkt in die Zukunft zu gehen.
Dennoch scheint es eine echte "Mammut-Aufgabe" zu sein, Prävention und Adaption zu betreiben. Die immer komplexer werdende Welt macht auch vor der Waldwirtschaft nicht halt. Alle forstlichen Entscheidungen müssen heute und in Zukunft den Klimawandelaspekt, die konkreten Standortgegebenheiten, Risiken und auch regionale Zukunftsszenarien mit berücksichtigen.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der Mensch durch den übermäßigen Ausstoß von CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen Auslöser des aktuellen Klimawandels. Die Auswirkungen des Klimawandels sind weltweit längst sicht- und spürbar geworden, wobei einige Regionen deutlich stärker betroffen sind als andere. Mit Klimawandel sind die Veränderung der atmosphärischen Zusammensetzung gegenüber 1850 und der damit einhergehende globale Temperaturanstieg gemeint. Das Jahr 1850 wird vom IPCC als Referenzzeitpunkt für seine Ausführungen herangezogen, da ab der industriellen Revolution die Klimaänderungen mit dem Anstieg des menschlichen CO2-Ausstoßes deutlich werden.
Die bisher auffälligsten globalen Klimaveränderungen:
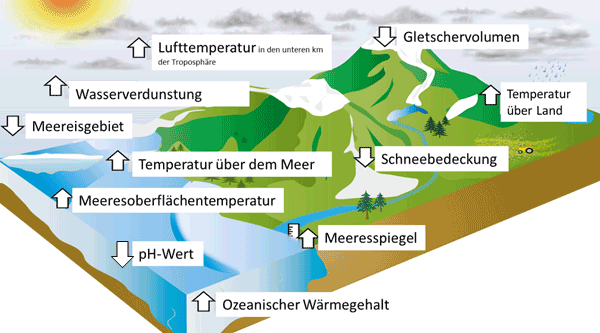
Abb. 1: Schematische Zusammenfassung der Auswirkungen des Klimawandels (leicht veränderte Darstellung, Quelle).
Durch den anthropogen verursachten Ausstoß von CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen ist es über den Landflächen und den Meeren wärmer geworden. Daher sind sowohl die Inlandeisgletscher, marine- und polare Eismassen sowie Permafrost-Zonen fast überall weltweit zurückgegangen. Das hat den Anstieg des Meeresspiegels zur Folge. Bisher haben die Ozeane sehr viel CO2 und Wärmeenergie aufgenommen und funktionieren als eine Art Puffer, jedoch nimmt der mildernde Effekt bereits ab. Die Ozeane erwärmen sich zunehmend und der pH-Wert sinkt.
Für Forst- und Landwirtschaft besonders bedeutsame Kenngrößen in Deutschland:
Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen
Das Jahr 2019 war mit einer Mitteltemperatur von 10,3 °C das zweitwärmste Jahr seit 1881. Gegenüber der international gültigen Klimareferenzperiode 1961-1990 ist bereits eine Abweichung von +2,1 Grad zu verzeichnen (Quelle). Für die Dekade 2071-2100 wird nach dem "weiter wie bisher Szenario" (RCP 8.5; mittlere Temperaturzunahme) ein Anstieg der Mitteltemperatur auf 12,5 °C (11,4-13,5 °C) erwartet (Quelle).
Verschiebung der Niederschläge vom Sommer in den Winter
Die Niederschlagsmengen schwanken wesentlich stärker als die Temperaturen. Es ist ein signifikanter Anstieg der Gesamtniederschläge von 1881 bis 2019 um 8,4 % festzustellen. Jahreszeitlich gesehen nahmen die Niederschläge im Sommer mit 3,8 % leicht ab und stiegen im Winter mit 25,8 % sehr deutlich an (DWD). Die stärksten Niederschlagszunahmen erfolgten dabei im Dezember, die deutlichsten Abnahmen im August. Es bestehen Regional jedoch sehr starke Unterschiede in der Niederschlagsentwicklung (weitere Informationen finden Sie hier).
Klimatologische Kenntage (Hitze und Kälte)
Als klimatologische Kenntage bezeichnet man beispielsweise Hitzetage, also Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 30 °C oder Eistage mit einer Höchsttemperatur unter 0 °C. Laut Monitoringbericht des Umweltbundesamtes von 2019 ist die durchschnittliche Anzahl der heißen Tage (gemittelt über ganz Deutschland) seit 1951 auf 10 Tage gestiegen (Quelle). Die Abnahme der Eistage von 27 auf 18 Tage/Jahr ist dagegen statistisch weniger signifikant, aber gesunken (Quelle). Mit 17 heißen Tagen war 2019 nach den Jahren 2018, 2003 und 2015 das Jahr mit den viertmeisten heißen Tagen seit 1951(Quelle). Mit Fortschreiten des Klimawandels ist mit länger werdenden heißen und trockenen Phasen und weniger langen Frostphasen zu rechnen. Das Spätfrostrisiko bleibt.
Stärkere Extremwetterereignisse
Sturm: über die Veränderung von Stürmen im Klimawandel herrscht bislang noch keine Einigkeit. Grund dafür ist das Fehlen konsistenter längerer Windgeschwindigkeitsmessungen. Jedoch zeigen alle Klimasimulationen eine stärkere anthropogene Beeinflussung des Klimas, die sich auch auf die außertropischen Wind und Sturmverhältnisse auswirken wird. Verschiedene Modellrechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass sowohl auf der Nord- wie auf der Südhalbkugel die Anzahl der starken Tiefdruckgebiete (mit einem Kerndruck unter 970 hPa) im Winter zunimmt, während die Gesamtzahl der Tiefdruckgebiete abnehmen wird (Quelle).
Hagel und Nassschnee: Statistische Auswertungen haben ergeben, dass das Hagelpotential in der Atmosphäre über die letzten Jahrzehnte zugenommen hat. Für genauere Angaben über zukünftige Änderung der Häufigkeit und/oder Intensität schwerer Hagelunwetter, sind weitere umfassende methodische Untersuchungen und Entwicklungen notwendig (Quelle). Durch die Verschiebung der Niederschläge in den Winter und die zeitgleiche Temperaturzunahme fallen die Winterniederschläge zukünftig eher in Form von Regen als Schnee. Die Änderungen der Schneetage schwanken jedoch ebenso sehr stark, weshalb die gemessenen regionalen Veränderungen nur in wenigen Fällen bisher signifikant sind (lesen sie hier mehr zum Thema Schnee).
Literatur- und Linktipps
- Die UN-Klimakonferenzen; Stand nach der 21. Klimakonferenz in Paris (2015); Kurzbericht des Süddeutschen Klimabüros, Dezember 2015: http://www.sueddeutsches-klimabuero.de/Info-Materialien_1861.php
- https://www.pik-potsdam.de/members/john/highlights/selbstverbrennung-schellnhubers-blick-aufs-ganze
- https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles-archiv/pressemitteilungen/alice-der-klimawandel-und-die-katze-zeta-ein-maerchen-ueber-die-wahrheit?set_language=de
- https://books.google.de/books/about/Klima_macht_Geschichte.html?id=kOoiAAAACAAJ&source=kp_cover&redir_esc=y
- https://books.google.de/books/about/Spielball_Erde.html?id=c72KbIxbkXUC&source=kp_cover&redir_esc=y
- https://www.pik-potsdam.de/aktuelles/nachrichten/unter-2-grad-edenhofer-in-buch-zum-pariser-abkommen
- Stürme im deutschen Binnenland; ein Dossier über Sturmentwicklung in Deutschland: http://www.klimanavigator.de/dossier/artikel/030136/index.php
Ratgeber Forstliches Krisenmanagement
Zurück zur Hauptseite des Ratgebers Forstliches Krisenmanagement: Übersicht der verschiedenen Themensammlungen
Zurück zur Artikelübersicht in der: Themensammlung Klimawandel - Wissen über und Bewusstsein für den Wandel