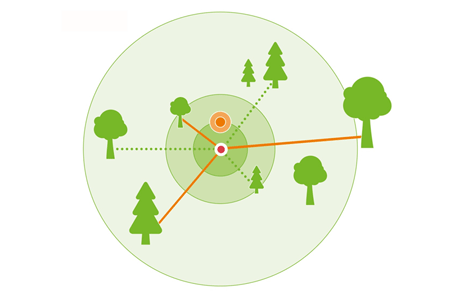Abb. 1: "Dicke Buchen sollst du suchen". Solche majestätische Erscheinungen finden sich nach wie vor nur selten in unseren Wäldern. (Foto: Adler/NABU)
BWI3 aus Sicht des verbandlichen Naturschutzes
Mit geschärftem Blick in die Zukunft
Doch es gilt auch, den Blick nach vorne zu richten. Bei allem Stolz der Försterinnen und Förster auf die eigene Zunft gilt es differenziert sowohl auf das Erreichte als auch auf das noch zu Erreichende zu blicken.
Für die Bestandsaufnahme und Bewertung der ökologischen Dimension der forstlichen Nachhaltigkeit lassen sich aus der BWI verschiedene Indikatoren heranziehen. Neben der oben bereits aufgeführten Naturnähe sind das vor allem Alter, Durchmesserverteilung, Anzahl und Qualität der Sonderstrukturen (Biotopbäume) im Wirtschaftswald, Menge, Qualität und Verteilung des Totholzes sowie der Anteil der Waldfläche, die sich in Richtung Urwald entwickeln darf.
Alters- und Durchmesserverteilung
Es liegt auf der Hand, dass mit Alter und Durchmesser eines Baumes auch die Habitatqualität steigt. Erfreulich ist daher, dass es bei beiden Faktoren Zuwachs gibt: Im Durchschnitt sind unser Wald älter und die Bäume dicker geworden. Die Natur interessiert sich allerdings weniger für den Durchschnitt als für die Extreme. Das schlichte älter werden von recht jungen Beständen allein sagt noch nichts über die Habitatqualität des Waldes aus. Verwundert sind die Naturschutzaffinen Leserinnen und Leser, wenn in der offiziellen Auswertung der BWI3 bei Bäumen ab 100 Jahren von alt und bei 50 cm starken Buchen von "dick" die Rede ist. Interessanter für den Naturschutz ist die Entwicklung der sehr alten Bäume (über 160 Jahre) und der sehr dicken Bäume (über 80 oder 90 cm BHD). Für die Buche lässt sich konstatieren, dass der Anteil starker Bäume über 70 cm BHD allgemein zugenommen hat. Der Anteil über 160-jähriger Buchen hat im Staatswald jedoch um 2% abgenommen und liegt bei 2.320 ha beziehungsweise 3% der Buchenfläche im Staatswald. Im Privatwald hat sich der Anteil hingegen über fast alle Größenklassen hinweg verdoppelt, von 1.500 auf fast 3.000 ha und macht damit 3,7% der Buchenfläche im Privatwald aus. Im Körperschaftswald hat der Anteil um ein Viertel auf 4.800 ha zugenommen und liegt damit ebenfalls bei 3,7% der Buchenfläche.
Es ist schwer zu spekulieren, warum die Fläche > 160-jähriger Buchenwälder im Staatswald abgenommen hat. Sind dafür die vom Naturschutz häufig kritisierten sehr starken Eingriffe und Räumungen von alten Buchenbeständen in den letzten 10 Jahren verantwortlich oder gibt es andere Gründe dafür? Die neue Waldentwicklungstypen-Richtlinie lässt hoffen, dass durch eine weitere Verbreitung des Dauerwaldprinzips auf größerer Fläche reife Bestände und damit auch flächenwirksam mehr einzelne "überreife" und wirklich "alte" und "dicke" Bäume im Wirtschaftswald erhalten bleiben.
Biotopbäume
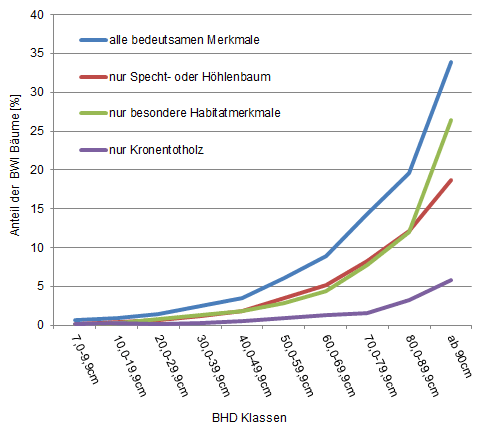
Abb. 2: Abgebildet ist der Anteil der in der in der BWI aufgenommen Bäume, die ökologisch besondere Merkmale haben, in Abhängigkeit vom Durchmesser.
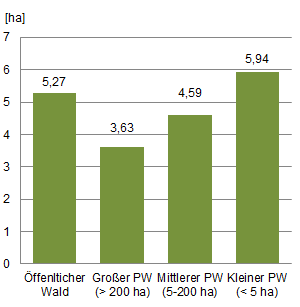
Abb. 3: Anzahl der Biotopbäume pro Hektar nach Waldbesitzarten.
Diese Hoffnung leitet über zu den bei der BWI3 erstmalig aufgenommenen Biotopbäumen. Im Unterschied zum Totholz sind dies lebende Bäume mit besonderen Habitatstrukturen wie Spechthöhlen, Mulmtaschen, Pilzbefall, Schürfstellen oder Blitzrinnen. Dabei handelt es sich überwiegend um starke Bäume > 50 cm BHD, was die oben aufgestellte These – je dicker, desto ökologisch wertvoller – bestätigt. Eindrucksvoll ist hier auch statistisch gesehen die hohe Korrelation zwischen Alter, Durchmesser und Habitatstrukturen, die die BWI offenlegt (Abb. 2). Für das Alter liegt die Korrelation bei r² = 0,94 und für den BHD bei r² = 0,99.
Überraschend ist hierbei das Ergebnis, dass sich die Anzahl der Biotopbäume mit durchschnittlich fünf pro Hektar zwischen den einzelnen Waldbesitzarten Baden-Württembergs kaum unterscheidet. Der Kommunalwald erreicht mit fast sechs Bäumen etwas mehr, was jedoch an den höheren Laubholzanteilen im Kommunalwald liegen dürfte. Erstaunlich ist, dass der Staatswald, der eigentlich Vorbildcharakter haben sollte, keine höhere Werte erreicht. Liegt das an der Zurückhaltung im Kleinprivatwald einerseits und der Ausreizung des Nachhalthiebsatzes im Staatswald auf der anderen Seite? Ein genauerer Blick scheint dies zu bestätigen: Wo ein hoher Vorrat ist und wenig Holz gemacht wird, da gibt es auch mehr Biotopbäume (Abb. 3).
Selbstverständlich sind die Auswirkungen des im Staatswald erst 2010 eingeführten AuT-Konzeptes in der BWI3 noch nicht abgebildet. Bis zur BWI4 dürfte hier dann wohl eine weitere Ausdifferenzierung zwischen den Waldbesitzarten stattfinden. Andererseits sieht auch das AuT-Konzept nicht mehr als durchschnittlich fünf Habitatbäume pro Hektar vor – also genau den derzeitigen Wert. Ist das Ziel also schon erreicht?
Entscheidend für den Naturschutz ist, dass Bäume mit besonderen Merkmalen tatsächlich im Bestand verbleiben dürfen und nicht im Sinne der traditionellen waldbaulichen Maxime "das Schlechte fällt zuerst" frühzeitig heraus selektiert werden. Es stellt sich die Frage, ob die BWI auch Rückschlüsse auf unterschiedliche Bewirtschaftungsmodelle und Waldbautraditionen zulässt. Dies wird der NABU in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg und der FVA im kommenden Jahr mittels Bachelorarbeiten weiter untersuchen.
Lebenselixier Totholz
Ein weiterer wichtiger Indikator für die ökologische Dimension forstlicher Nachhaltigkeit ist das Totholz. Auch hier ist zu differenzieren zwischen einer rein mengenmäßigen Betrachtung und der Qualität des Totholzes nach Stärke, Länge, Zersetzungsgrad und ob es stehend oder liegend ist. Auch ehemalige Sturmflächen mit ihren naturgemäß hohen Anteilen an geworfener Biomasse sind für den Naturschutz bedeutsam. Bei der Bewertung der forstlichen Nachhaltigkeit interessiert jedoch besonders, was im Rahmen der planmäßigen Nutzung für die Natur übrig bleibt. Im Vergleich zur BWI2 lässt sich bei der sturmbereinigten Betrachtung eine leichte Zunahme von 2,4 Fm beziehungsweise 17% pro Hektar feststellen. Auch hier lassen sich Unterschiede zwischen den Waldbesitzarten feststellen: Der Staatswald ist mit 18,3 m³ Totholz pro Hektar führend, gefolgt vom Körperschaftwald (16,3 m³) und dem Privatwald (14,7 m³) (Totholzwerte hier zur besseren Vergleichbarkeit nach BWI2 Methode (Kluppungsgrenze 20 cm) und ohne Sturmflächen): Ob der höhere Wert im Staatswald tatsächlich auf eine "totholzfreundlichere" Bewirtschaftung oder vor allem auf die höheren Anteile nutzungsfreier Schutzgebiete zurückzuführen ist, bedarf einer weitergehenden Analyse. Jedenfalls liegen jene Schutzgebietskategorien mit besonders hohen Totholzanteilen (Bannwälder 85 m³/ha; Schonwälder 46 m³/ha; NSGs 41 m³/ha) überwiegend im Staats- und auch im Körperschaftswald. Zusätzlich sollten topographische Besonderheiten wie Schluchten und Klingen in die Auswertung miteinbezogen werden.
Ganz unabhängig davon ist es bemerkenswert, dass die relative Zunahme des Totholzes seit BWI2 (ohne Sturmflächen) mit 26% im Privatwald am größten ist. Wie bei den Biotopbäumen, korreliert auch das mit der Vorratszunahme und der Zunahme der Waldbestände über 140 Jahre im Kleinprivatwald.
Wieviel Totholz ist genug?

Abb. 4: Weißrückenspecht in den Chiemgauer Alpen (Foto: Sgbeer/Wikimedia)

Abb. 5: Der Ästige Stachelbart (Hericium coralloides). einst typisch für die heimischen Buchenwälder, gilt heute fast schon als Urwaldreliktart.
Bei der Frage, wieviel Totholz die waldtypische Artenvielfalt braucht, um zu überleben, ist die Wissenschaft ein gutes Stück vorangekommen. Musste man sich früher weitgehend auf die Meinung von Expertinnen und Experten und auf das Bauchgefühl verlassen, gibt es heute für verschiedene Arten und Artengruppen sogenannte Totholzschwellenwerte. Sie stellen die Mindestmenge an Totholz dar, ab der die Abundanz und Diversität waldtypischer Arten- oder Artengruppen signifikant zunimmt. Dabei gibt es einen ersten Schwellenwert im Korridor zwischen 30 und 70 m³ Totholz pro Hektar. Bei noch anspruchsvolleren Arten – zumeist ausgeprägte Totholzspezialisten – beginnt ein weiterer Schwellenwert ab 90 m³/ha (Die Kluppungsgrenze für die Herleitung der Totholzschwellenwerte nach Müller und Büttler (2012) liegt bei 12 cm). Für den Gesamtwald in Baden-Württemberg weist die BWI3 einen Durchschnittswert von 28,83 m³/ha Totholz auf (BWI3 Methode (d. h. Kluppungsgrenze 10 cm) und Sturmflächen inbegriffen). Damit liegt Baden-Württemberg hier im Mittel an der unteren Grenze des unteren Totholzschwellenwertes. Dies ist für sich genommen erfreulich. Die spannende Frage ist, wie diese Werte nicht nur erhalten werden, sondern wie noch höhere Werte erreicht werden können und auch wie das Totholz räumlich verteilt sein muss. Denn auch hier zählt weniger der Durchschnitt als das Vorhandensein von Extremen. Sicherlich kann es nicht das Ziel sein, auf ganzer Fläche 70 oder gar 100 m³/ha Totholz zu "erwirtschaften". Ein räumlich differenziertes Modell, wie etwa das baden-württembergische AuT-Konzept scheint – sofern es konsequent umgesetzt wird – zielführender. Neben einzelnen Habitatbäumen und Habitatbaumgruppen als Grundgerüst stehen die Waldrefugien mit Flächengrößen von einem bis zehn Hektar zur Verfügung. Dort können gebietsweise Totholzschwellenwerte von 70 m³/ha und mehr erreicht werden. Quasi per "Inselhopping", so die Theorie, können Arten, die auf die Alters- und Zerfallsphasen des Waldes angewiesen sind, zwischen diesen Refugien wandern und sich genetisch austauschen. Einzelne Habitatbäume und Habitatbaumgruppen dienen dabei als Trittsteine. Voraussetzung: Die Arten sind mobil genug für diesen "Lebensstil" und sie erreichen damit Populationsgrößen, die ihnen ein kontinuierliches Überleben von sich fortpflanzenden Populationsmitgliedern ermöglichen.
Dieses Konzept der "minimum viable population" gilt allerdings auch für die weniger mobilen und anspruchsvolleren Arten. Auch sie brauchen – sofern sie erhalten werden sollen – überlebensfähige Populationen.
Totholzschwellenwerte und Sonderstrukturen in der Größenordnung von 100 m³/ha und mehr lassen sich in enger räumlicher und zeitlicher Verzahnung jedoch kaum mit Habitatbaumgruppen und Waldrefugien erreichen. Es sind die Bannwälder und Kernzone der Biosphärenreservate und Nationalparke, die für die besonders anspruchsvollen und weniger mobilen Arten die letzten Refugien darstellen. Auch mobilere Arten profitieren davon, indem sie die Gebiete als Spenderfläche nutzen, von denen sie sich ausbreiten können. Ein Beispiel: Der Weißrückenspecht, ursprünglich ein typischer Bewohner der mitteleuropäischen Laubmischwälder, ist heute nur noch mit wenigen Brutpaaren in entlegenen Revieren der Voralpen anzutreffen. Er braucht kontinuierlich rund 60 m³ Totholz pro Hektar. Ein Inselhopping wäre ihm durchaus zuzumuten, wenn seine Ausgangspopulation groß genug ist, verlorene Gebiete zurückzuerobern. Der Schutz und die Förderung des Weißrückenspechts in seinen jetzigen Brutgebieten muss daher eine hohe Priorität für den Waldnaturschutz haben. Zu den weniger mobilen und häufig auch weniger bekannten Arten gehören zahlreiche Mulm- und Pilzspezialisten unter den Käfern. Aber auch Pilze wie die mittlerweile prominente Zitronengelbe Tramete, die erst vor kurzem im Bannwald Wilder See nachgewiesen worden ist. Ihr Totholzschwellenwert liegt bei kontinuierlichen 144 m³/ha.
Hausaufgaben: AuT und Waldschutzgebietsprogramm
Damit wird der Ruf des Naturschutzes nachvollziehbarer: Ohne ungenutzte Waldflächen kann es keine umfassend nachhaltige Forstwirtschaft geben! Diese Feststellung, die bei den Fachleuten der forstlichen Versuchsanstalten schon längst angekommen ist, muss sich endlich in der Rhetorik der forstlichen Verbände wiederspiegeln. Die Forderung nach einem Flächenanteil von 5% ungenutzter Waldfläche ist gewiss pauschal. Niemand weiß, ob auch 3% ausreichen würden, oder ob doch eher 10 oder 15% nötig sind. Ganz sicher hängt dies auch von der ökologischen Qualität des Wirtschaftswaldes ab. Maßstab sollte letztendlich der Erhaltungszustand der stark gefährdeten Waldarten sein. Deshalb ist der Aufbau eines Monitoringsystems für bedrohte Waldarten so wichtig und es ist gut, dass ForstBW dies mit der Gesamtkonzeption Waldnaturschutz vorsieht. Bis diese Sicherheit gewährleistet wird, sollte allerdings das Vorsorgeprinzip gelten. Und das sind die 5%.
Wie steht es um die Erreichung dieses Ziels: Laut BWI3 liegt der Anteil ungenutzter Waldflächen in Baden-Württemberg derzeit gerade mal bei 1,5%. Ein Defizit von fast 46.000 ha. Da der Staatswald bis 2020 sein Ziel (10%) voraussichtlich erreichen wird, steht hier vor allem der Kommunalwald vor einer großen Aufgabe. Rund 23.500 ha wären im Kommunalwald zu suchen, weitere 7.500 ha im Privatwald, um die 5% in Baden-Württemberg zu erreichen. Wenngleich der Grundsatz der Freiwilligkeit für den Kommunal- und Privatwald auch für den NABU Gültigkeit hat, muss sich die Politik schon überlegen, ob die vorhandenen Anreize und Mechanismen ausreichen, um das 5%-Ziel bis 2020 zu erreichen.
Und dann wären da noch…
…die Lichtwaldarten. Jene Wesen, die sich scheinbar überhaupt nicht mit Totholzschwellenwerten und Prozessschutz vereinbaren lassen. Vom Ziegenmelker über den Eichenzipfelfalter, den Wendehals bis hin zur Äskulapnatter. Ganz sicher bedürfen dieser Arten einer besonderen Aufmerksamkeit. Zeitgemäße Managementkonzepte zum Schutz dieser Arten stecken teilweise noch in den Kinderschuhen. Sicher ist jedoch, dass auch diese Waldarten in den Verantwortungsbereich einer multifunktionalen und nachhaltigen Forstwirtschaft unseres Landes fallen.